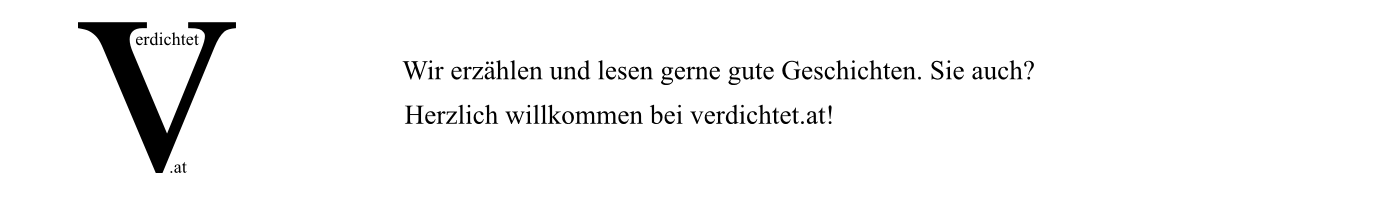- Alentejo
- Algarve
- Folegandros
- Gavdos
- Günthers Schüttelreime
- Haikus
- hofgasse 12
- Im Alsergrund
- Im Fischerdorf
- Immer zurück zum Pruth
- Eine kleine italienische Reise
- Das Museum der Brentanos: Ankunft
- Das Museum der Brentanos: Abfahrt
- Ode an eine Ionische Insel
- Die Sonnenfinsternis vom Mittwoch, 11. August 1999, am Faaker See
- Unter der Haut 1 und Unter der Haut 2
- Via Amalfi
Kategorie-Archiv: Günther Androsch
Unter der Haut 2
Stop! Davor ist schon einiges passiert, im Teil 1 der Geschichte.
Ich stimmte zu, und Axel drückte mir den ausgedruckten Vertrag in die Hand. Vor Augen hatte ich, endlich das Terrain des dilettierenden Amateurs zu verlassen und die Schachfiguren nicht nur zu ziehen, sondern ihnen eine dominante Wirkung zu verleihen, endlich Spiele auch gegen starke Gegner zu gewinnen und bei Turnieren ein Wörtchen mitzureden. Allerdings, führte der Vertrag aus, müsse ich für meine Teilnahme an Schachturnieren die Erlaubnis des Veranstalters einholen, sonst handle es sich um den Gebrauch unerlaubter Hilfsmittel, also technologisches Doping. Im privaten Bereich, etwa im Schachklub, sei ethisches Handeln meine Entscheidung. Bei einer Nichtbeachtung trüge alleine ich die Verantwortung, nicht New Spirit. Ich unterschrieb den Vertrag, außer der Frage des technologischen Dopings waren mir keine kritischen Punkte aufgefallen, auch die Schweigepflicht erschien mir einsichtig. Axel schlug mir einen Termin für die Implantation vor, ich stimmte zu. Er wiederholte die kritischen Punkte, außerdem bot er mir eine Betreuung durch einen auf technologische Entwicklungen spezialisierten Psychologen an.
„Ich komme sicher alleine zurecht“, sagte ich großspurig. „Falls ich Hilfe brauche, wende ich mich an dich, weil ich dich schon länger kenne.“
Der Eingriff sei aufwändiger als beim ersten Chip, erläuterte Axel. Der neue Chip werde in die Regionen Precuneus und Nucleus caudatus, die vor allem bei Schachprofis erhöhte Aktivität zeigten, implantiert. Eine Computersimulation veranschaulichte den Vorgang, der schon im Vertrag beschrieben worden war. Dann betäubte mich Axel mit einer leichten Narkose, um mit einem Spezialbohrer eine winzige Öffnung in die Schädeldecke an der betreffenden Gehirnregion zu bohren. Mit einem biokompatiblen Kleber befestigte er den winzigen Chip, der eine Unzahl an Daten und Algorithmen speicherte, unter der Schädeldecke an der Hirnoberfläche. Nach einigen Minuten wachte ich auf, es war alles vorbei, ohne dass ich das Geringste gespürt hatte. Ich fühlte mich wie upgedatet, und ich war heiß darauf, die getunte Kompetenz meines Gehirns, wenigstens beim Schach, zu erleben.
Ich loggte mich auf meiner Lieblingsplattform für Online-Schach Queen@King.com ein. Eigentlich durfte ich nur gegen Maschinen spielen, aber die Hinweise im Vertrag und die Warnungen Axels, kein betrügerisches Verhalten zu zeigen, schlug ich in den Wind, zu verführerisch war es, die Wirkungen des Chips ohne jegliche Rücksichtnahme, ohne Verzögerung zu erproben. Es wusste doch niemand davon! Und schweigen musste ich sowieso wie ein Grab!
Und tatsächlich, mir ging jeder Zug rasch von der Hand, aber vor allem hatte es die Qualität der Züge in sich. Ich gewann mit wenigen Ausnahmen jede Blitzpartie auf Queen@King.com, verbesserte mein Rating rasant. Meine Bilanz mit Gegnern, gegen die ich bisher immer verloren hatte, kehrte sich um. Ich nahm süße Rache. War ich überhaupt noch schlagbar? Von Menschen kaum, vielleicht von stärkeren Programmen als jenem auf meinem Mikrochip. Wenn ich eine Maschine als Gegner wählte, bekam meine Überlegenheit das eine oder andere Mal einen Dämpfer, doch überwogen insgesamt meine Siege.
Während ich früher gegen Axel nicht den Funken einer Chance gehabt hatte, schlug ich ihn nun mit wenigen Ausnahmen, und bald verlor er das Interesse, gegen mich zu spielen. Im Schachklub staunten die Kollegen über meine Wandlung vom fehleranfälligen Amateur, vom Patzer zum ernstzunehmenden Spieler. „Was ist los mit dir?“, fragten sie mich. „Wie konntest du deine Spielstärke derart verbessern? Nimmst du ein Zaubermittel ein?“ „Ich habe Online-Kurse belegt und mich richtig reingehängt“, flunkerte ich. „Und, ihr werdet es nicht glauben, ich habe in alten Schachbüchern, die ich von meinem Vater geerbt habe, kaum bekannte Varianten studiert, die die Gegner vor Probleme stellen.“ Meine Vereinskollegen gaben sich mit meiner Begründung nicht wirklich zufrieden, merkte ich, sie insistierten aber nicht.
Ich nahm an Wochenenden und im Urlaub an Schachturnieren teil, zunächst im lokalen und regionalen Bereich, dann im nationalen, schließlich im internationalen. Problemlos kam ich in die Preisränge, das eine oder andere Turnier beendete ich als Sieger. Ich spielte sogar mit dem Gedanken, meinen Beruf sein zu lassen und meinen Lebensunterhalt als Schachprofi zu bestreiten. Man sprach mich an, ob ich gegen eine Punkteprämie bei renommierten Vereinen spielen wolle. Die Verlockungen waren groß, aber trotz aller Euphorie blieb die Vorsicht vor zu großer Veränderung. Regelmäßig berichtete ich Axel über mein Befinden und über die Auswirkungen des Chips, über meine Vergehen schwieg ich. Das kleine Ding erzeugte ein Gefühl der Überlegenheit, es stärkte mein Selbstbewusstsein, und wenn es auch ein Alleinstellungsmerkmal bloß im Schach darstellte, entstand nach und nach eine allgemeine Hybris.
Mit der Zeit fühlte sich die ständige Überlegenheit wie ein unnatürlicher Zustand an, der mein psychisches und soziales Befinden durcheinanderbrachte. Ich vernachlässigte meine Freundinnen und Freunde. Selbst die Treffen mit Axel interessierten mich nicht mehr, seit ich fast jede Partie gewann, während er darauf aus wissenschaftlichem Interesse bestand. Meine Unzufriedenheit mit mir und mit meinem Verhalten meinen Mitmenschen gegenüber wuchs. Immer öfter kam es mir vor, als bestimme ein fremder Geist mein Denken, nicht nur im Schach, unterdrücke meine Gedanken und weide sich an meiner Unselbständigkeit. Der überragende Erfolg der Software auf dem Chip stand meiner Ausgeglichenheit, meinem Kommunikationsbedürfnis, stand anderen Interessen entgegen. Zwei Geschwindigkeiten befanden sich im Widerstreit, meine persönlich menschliche und die fremde, präzise, blitzschnelle Software des kleinen künstlichen Teils in meinem Hirn.
Manchmal schreckte ich im Schlaf auf, weil ich träumte, ein fremdes Organ sei gegen meinen Willen in meinen Körper verpflanzt worden und wachse und erdrücke die lebenswichtigen Organe. Immer mehr litt ich an Schlaflosigkeit, wälzte mich schweißgebadet im Bett hin und her, Schachbrettmuster und Stellungen flimmerten vor meinen Augen, die gelöst werden wollten. Wenn ich überhaupt ein Auge zutun konnte, schreckte ich bald mit Herzrasen auf. Ich kam immer weniger mit dem Status quo zurecht, fühlte mich mehr und mehr zerrissen. Hatte ich schizophrene Anteile, für die der Mikrochip verantwortlich war? Oder hatte er das Asperger-Syndrom entstehen lassen? Konnte ich mich dagegen wehren, ohne meine schachliche Kompetenz einzubüßen? Ich konnte mich nicht an das letzte Buch erinnern. Nicht einmal die Zeitung interessierte mich mehr, ich hörte keine Musik, kein Radio, ein Theater sah ich höchstens von außen, alles und jedes war dem Geist des Chips untergeordnet. Ich musste mit Axel darüber reden.
Wir trafen uns im Café am Fluss. Ich schilderte Axel meine Verzweiflung. Er war nicht überrascht. „Auch andere Testpersonen, denen ich einen Chip ins Hirn implantiert habe“, sagte er, „zeigen ähnliche Symptome.“
Aber Axel betrachtete sie offenbar als vorübergehend. „Du wirst dich an die Symbiose mit dem Chip gewöhnen“, sagte er, „du lebst erst ein paar Monate damit. Die Menschen müssen sich mit bisher unbekannten Situationen auseinandersetzen und damit zurechtkommen.“
„Aber steht das alles im Einklang mit unserer Befindlichkeit, mit unserer Psyche, mit unseren menschlichen Eigenschaften?“, fragte ich. „Ich komme damit nicht zurecht.“
„Der Mensch wird damit leben lernen, es ist ein Schritt der Evolution“, sagte Axel.
Es blieb in mir die Spaltung zwischen der Faszination und der Angst davor, was diese Entwicklung auslösen könnte, ja schon ausgelöst hatte. Auch der Begriff Hirnwäsche, der beim Implantieren von Chips nahelag, kam mir in den Sinn. Ich sprach Axel darauf an.
Er hielt mir entgegen: „Jeder technische und technologische Fortschritt – ich weiß, das ist eine Floskel – ist Fluch und Segen zugleich. Aber dass die Gewöhnung sukzessive erfolgen muss, vorsichtig, um die Menschen nicht zu überfordern, ist mir bewusst. Insofern habe ich den Fehler begangen, viel zu rasch vorgegangen zu sein. Daher mache ich dir einen Vorschlag: Wir entfernen den Mikrochip wieder. Den in deinem Hirn, meine ich. Du wirst wieder der Mensch sein, der du vor der Implantation warst, aber nicht gleich, weil du dich an die Umkehr ebenso wirst gewöhnen müssen. Solltest du zufrieden damit sein, hast du immerhin eine interessante Erfahrung gemacht.“
„Ja“, sagte ich, „missen möchte ich die Zeit nicht.“
„Und weil wir den ersten Chip lassen“, sagte Axel, „kannst du weiterhin dessen Funktionen nützen. Vielleicht erwacht ja nach einigem Abstand wieder die Sehnsucht nach dem perfekten Spiel in dir oder nach der perfekten Sprachbeherrschung und du traust dir einen zweiten Versuch zu.“
Ich atmete auf. „Das machen wir“, sagte ich, „wenn’s nach mir geht, so rasch wie möglich.“
„Ich habe meine Termine nicht im Kopf“, sagte Axel. „Ruf mich morgen an, dann nehmen wir den nächsten freien Termin.“
Das tat ich. Axel entnahm, nachdem er mich unter eine leichte Narkose gesetzt hatte, den Mikrochip aus meinem Hirn. Die kleine Wunde verklebte er, bald war sie verheilt. Wir trafen uns wieder regelmäßig im Café am Fluss, und ich berichtete Axel über meine Befindlichkeit. Meine Fähigkeiten standen wieder im Einklang mit meiner Persönlichkeit und ich fand zu innerer Ruhe zurück. Jeden Donnerstagnachmittag las ich die Wochenzeitung. Zum digitalen Schach hielt ich Abstand. Irgendwann spielten Axel und ich auch wieder Schach gegeneinander, völlig entspannt und eher nebenbei, weil die Unterhaltung im Vordergrund stand. Axel gewann wie früher regelmäßig, er war wieder mein Lehrmeister. Im Schachklub erklärte ich den Rückschritt zu meiner früheren Spielstärke mit beruflichen Gründen. Und eine gewisse Vergesslichkeit mache sich auch bemerkbar. Das klang überzeugend, und vor allem letzteres war keine Lüge.
Ich fühlte mich wieder als persönliche Einheit, deren Komponenten zwar im Widerstreit standen, aber in der Regel einen Konsens fanden.
Freilich traute ich der Ruhe nicht. Axel hatte vielleicht bald wieder einen Vorschlag, der mich in seinen Bann ziehen würde.
Günther Androsch
www.verdichtet.at | Kategorie: ¿Qué será, será? | Inventarnummer: 25072
Unter der Haut 1
Jeden Donnerstagabend nach der Arbeit am Institut für Theoretische Festkörperphysik las ich im Café am Fluss die schwere Ausgabe einer Wochenzeitung. Einmal fiel mir eine großformatige Anzeige auf, die die Implantation von Mikrochips, die relevante persönliche Daten speicherten, in den menschlichen Körper bewarb. Die Firma New Spirit bezog die Chips aus dem Fernen Osten, stattete sie mit der erforderlichen Software und mit einem biokompatiblen Schutzglas aus und richtete die vollständige Technologie ein, etwa am Eingang von Häusern, Wohnungen, an Autos usw. Die persönlichen Daten würden verschlüsselt, hieß es, so sei man gegen Angriffe von Hackern geschützt. Die Anwendung bei Haus- und Nutztieren sei bereits Routine. Besonders behinderte Menschen könnten die Vorteile, die ständig weiterentwickelt würden, nutzen. Die Implantation, ein kleiner medizinischer Eingriff, werde von dem erfahrenen Arzt Dr. Axel Matt vorgenommen. Die juristischen Belange seien ausgearbeitet, ein Vertrag zwischen New Spirit und einer interessierten Person müsse abgeschlossen werden.
Die Werbung machte einen seriösen Eindruck, die Technologie als Ergänzung des Menschen weckte meine Neugier. Der Chip vereinheitlichte Funktionen von Bankomat- und Kreditkarten, Karten im Gesundheitsbereich, und statt einer Unzahl verschiedener Karten und Schlüsseln, die man jederzeit verlieren konnte und die eine Menge Platz einnahmen, hatte man alle wichtigen Daten auf dem Chip, die ein geeignetes Gerät lesen konnte.
Ich war fasziniert, gleichzeitig begleitete mich ein mulmiges Gefühl vor dem Unbekannten. Nicht nur der Reiz der neuen Entwicklungen, auch das Wissen, in meinem persönlichen Umfeld eine Vorreiterposition einzunehmen, setzte sich gegen meine Bedenken durch. Ich kontaktierte die Ansprechperson Dr. Axel Matt, der mich zu einem Gespräch einlud. Im Internet und auf der Homepage von New Spirit bereitete ich mich darauf vor. Als ich Dr. Matts Büro betrat, saß mir ein Mann mittleren Alters im weißen Poloshirt mit dichtem schwarzen Haar, dunklen Augen und schwarzem Schnurrbart gegenüber, auf dessen schmalem Gesicht ein Lächeln lag. Er erhob sich und ging mir entgegen, dabei fiel mir auf, dass er um einiges größer war als ich. Wir stellten uns einander vor.
„Kaffee?“, fragte Dr. Matt.
„Lieber ein Glas Wasser“, sagte ich. Eine Dame brachte es umgehend.
Der Mikrochip werde, sagte Dr. Matt, unter der Haut zwischen Daumen und Zeigefinger implantiert. Das Gespräch, in dem er mir die Technologie erläuterte, bestärkte meine positive Einstellung, auch die Kosten für mich hielten sich in Grenzen. Nach ein paar Tagen des Nachdenkens unterschrieb ich den Vertrag, erschien zum vereinbarten Termin, wählte die linke Hand und ließ mich auf dem Behandlungsstuhl nieder. Dr. Matt nahm eine örtliche Betäubung vor. Ich konnte auf einem Monitor verfolgen, wie er mit einer Art Injektionsnadel das kleine Ding in die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger injizierte. Die Öffnung in der Haut nähte er nicht, sondern klebte ein Spezialpflaster darüber. „Das war’s“, sagte er, „ich werde mir die Folgen des kleinen Eingriffs anschauen. Das Pflaster kann ich bald entfernen. Nachwirkungen sollte es kaum geben, vielleicht etwas Jucken, das Sie mit einer Salbe behandeln. In der ersten Zeit wird Sie der Fremdkörper irritieren, aber dieses Gefühl wird wahrscheinlich verschwinden. Wenn nicht, wenn gar Ablehnung entsteht, entferne ich den Chip wieder und Sie müssen leben wie bisher.“
Der Juckreiz hielt sich in Grenzen, den war ich wegen meiner trockenen Haut sowieso gewohnt. In den ersten Tagen störte mich in der Tat das Gefühl, ein fremdes Teil in mir zu tragen, das eher dem Wissen davon geschuldet war, weniger einem physischen Empfinden. Bald spürte ich nichts mehr. Ich nutzte die Funktionen des Chips, betrat mein Haus, den Keller, die Garage, öffnete mein Auto, bezahlte im Supermarkt. Es war phantastisch! Die Funktionen schienen von mir selbst auszugehen, als genügte allein mein Wille.
Nach einigen Wochen waren keine Kontrollen mehr notwendig. Aber Dr. Matt schlug vor, uns regelmäßig zu einem Austausch zu treffen, der meine Erfahrungen mit dem Mikrochip betreffe, aber auch darüber hinausgehen könne. Wir trafen uns im Café am Fluss. Dr. Matt saß an der Spiegelwand und las in der Zeitung. Wir begrüßten uns, und ich nahm ihm gegenüber Platz.
„Ist alles in Ordnung?“, fragte er.
„Alles bestens“, sagte ich.
„Ich habe nichts anderes erwartet“, sagte Dr. Matt. „Sie sind zwar ein Pionier für die Implantation, aber auf unser Inserat, das wir regelmäßig schalten, melden sich immer mehr Menschen, zum großen Teil Männer, leider, doch gibt es auch einige interessierte Frauen.“
Am Nebentisch spielten zwei Männer Schach. Dr. Matt erzählte, dass er, als er in Frankfurt am Main als Neurologe tätig gewesen sei, in der 2. Deutschen Bundesliga gespielt habe. Ich hingegen kam bloß in der Kreisliga zum Einsatz. Wir fragten den Ober, ob es eine Schachgarnitur gebe. Der bejahte und brachte sie umgehend. Nach zwei raschen Partien merkte ich, dass sich unsere Spielstärken haushoch zugunsten Dr. Matts unterschieden. Wir spielten ohne Uhr, und er kommentierte unsere Züge.
„Gens una sumus ist der Leitspruch der FIDE, des Weltschachverbands“, sagte er.
„Ich weiß“, sagte ich.
„Wenn wir schon Familienmitglieder sind, „können wir uns doch duzen.“
„Einverstanden. Ich bin Gregor.“
„Und ich Axel.“
Von da an trafen wir uns jeden Donnerstagabend nach meiner Zeitungslektüre. Meist spielten wir zwei Partien Schach, dann unterhielten wir uns. In Dutzenden Partien erreichte ich vielleicht drei, vier Remis. Bald beschränkten wir uns darauf, dass ich Axel meine in der Kreisliga gespielten dürftigen Partien zur Analyse vorlegte. Das war mir lieber, als Analysemodule im Internet zu befragen. Eines Donnerstagabends sagte Axel, er habe einen Vorschlag, der mich vielleicht interessiere.
„Du machst mich neugierig“, sagte ich.
„Wir arbeiten mit dem Zentrum für Hirnforschung am hiesigen Klinikum zusammen“, sagte Axel, „und mit mehreren Einrichtungen, die sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen, wie du weißt.“
„Mach’s nicht so spannend“, sagte ich.
„Wir haben Mikrochips entwickelt“, sagte Axel, „die gewisse Hirnfunktionen unterstützen und als Ergänzung des Menschen Großartiges werden leisten können.“
„Das hört sich ja nach Science Fiction an“, sagte ich und merkte, wie Leidenschaft in Axel keimte.
„Mittlerweile“, setzte er fort, „sind wir der Realität sehr nahe. So wollen wir Chips entwickeln, die den Wortschatz einer Sprache beinhalten, sodass kein Mensch mehr Vokabeln lernen muss. Wir denken auch daran, Syntax und Semantik zu programmieren. Niemand muss dann mühsam Grammatik, Interpunktion und Orthographie lernen. Gleiches gilt für Fremdsprachen. Und wir sind zuversichtlich, bald gegen das Vergessen erfolgreich zu sein, Erinnerung zu speichern, ohne dass sie verblasst.“
Axel beschrieb die Pläne von New Spirit zwar sachlich, aber ich merkte, dass er seinen Enthusiasmus zügeln musste. Er setzte fort: „Dich dürfte Folgendes besonders interessieren. Wir haben einen Mikrochip mit Schachsoftware entwickelt, den wir ins menschliche Gehirn einpflanzen und der die Gedanken und Impulse der spielenden Person steuert, jedenfalls bereichert.“
Ich war hellhörig geworden. „Und gibt es damit schon Erfahrungen?“, fragte ich.
„In den Vereinigten Staaten ja“, sagte Axel, „in Europa weniger, da ist New Spirit Vorreiter. Der Chip ist fix und fertig, er wartet nur noch auf seinen Einsatz. Deshalb suchen wir Testpersonen, die sich den Chip ins Gehirn einpflanzen lassen.“
Axel machte eine Pause. Es war mir klar, dass er gerade mich darauf ansprach, der ich neuen Technologien gegenüber offen war und für Schach etwas übrighatte. Die neue Anwendung bewegte sich im Neuland, das machte den Reiz aber nur noch unwiderstehlicher.
„Ich weiß, worauf du hinauswillst“, sagte ich. „Ich will’s wagen, obwohl ich gleich an rechtliche und ethische Fragen denke.“
„Darauf gehen wir im Vertrag ein“, sagte Axel. „Wir sprechen vor der Implantation selbstverständlich darüber. Zur Sicherheit warten wir bis übermorgen, dann kannst du den Vertrag studieren und darüber nachdenken.“
Gespannt, wie es weitergeht?
Dann am besten gleich weiter zu Teil 2 der Geschichte ...
Günther Androsch
www.verdichtet.at | Kategorie: ¿Qué será, será? | Inventarnummer: 25071
Ode an eine Ionische Insel
Angesichts des attisch blauen Meers
Das Kefalonia
Die Krone der Ionischen Inseln
Umgibt
Meint man
Nach dem Genuss
Des süffigen Weins
Die antiken Götter
Verbergen sich
In den Zypressen- und Ölbaumhainen
Und haben uns
Im AugeUnd blickt nicht Odysseus selbst
Vom Enos
Auf das attische Blau
In dessen Dunst
Himmel und Meer verschmelzen?
Günther Androsch
www.verdichtet.at | Kategorie: hin & weg | Inventarnummer: 22092
Im Fischerdorf
Zu Füßen der Steilküste
Liegt Olhao
An den Ufern
Des AtlantiksUnd in der Nähe
Schmiegen sich römische Villen
An die Küste
Als stünde die Zeit
Seit mehr als zweitausend Jahren
Still.Unterm Augusthimmel
Peitscht die Brandung
Gegen die FelsenFür eine kurze Zeit
Trübt die Gischt
Die Sicht
Auf die Welt.
Günther Androsch
www.verdichtet.at | Kategorie: hin & weg | Inventarnummer: 22091
Gavdos
Ein südlicheres Eiland
Ein Eiland
Dem die Zeit entschwunden ist
Kennt Europa nichtGavdos weckt
So will ich sie nennen
Arkadische Gefühle
Wenn durch den brennend heißen Sand
Zum Strand ich stapfe
Agios Ioannis zuMystisch muten
Die Buchten an
Und wunderbar kitschig
Steigt Tag für Tag
Die Sonne über den Horizont
Und sinkt abends
Nicht minder kitschig
Hinter ihn
Günther Androsch
www.verdichtet.at | Kategorie: hin & weg | Inventarnummer: 22090
Folegandros
Eile?
Was ist das?
Fragst du
Die entrückt im Meer ruht
Als stiller FelsHellgrün hellblau
Leuchten die Sessel
Der Tavernen der Cafés der Bars
Hin und wieder
Räkelt eine Katze
Sich im SchattenHoch über Chora
Versinkt die Sonne
In der Ägäis
Wie für eine PostkarteHin und wieder trägt der Wind
Einen Hauch Musik her
Der zu lauschen
Sich selten lohnt
Günther Androsch
www.verdichtet.at | Kategorie: hin & weg | Inventarnummer: 22089
Algarve
Die Gischt
Schlägt
An deine Strände
Und stetig
Durchdringt der Fado
Alle Dinge
Selbst manches Tier
Die Menschen sowiesoAbends munden
Die Meerestiere
Zum schweren WeinUnd unter den Mandelblüten
Glaubt man sich
In einem irdischen Paradies
Günther Androsch
www.verdichtet.at | Kategorie: hin & weg | Inventarnummer: 22088
Alentejo
Hoffnung im Alentejo
Seinen großen Roman
Schrieb José Saramago dort
Wo die Fischer in ihren Booten
Auf einen Fang warten
Und dann und wann beißt ein Sargo
Ein BarschTróia Comperta Pinheirinho
Heißen die Strände des Alentejo
Unbarmherzig
Blenden sie das AugeNach Westen nichts als Wasser
Der Große Teich
Und dennoch gibt es
Einige Menschen
Die des Schwimmens
Unkundig sind
Mein Ozean hat Fliesen
Sagen sie
Günther Androsch
www.verdichtet.at | Kategorie: hin & weg | Inventarnummer: 22087
Immer zurück zum Pruth
Galizien und die Bukowina: Eine Reise in eine literarische Landschaft an Dnister, Pruth und Sereth
(Der Titel ist eine Verszeile aus Rose Ausländers Gedicht Pruth)
Am 25. Februar 2022 erhielt ich einen Anruf, bei dem das Display meines Handys den Namen Renate zeigte, der mir nicht gleich geläufig war. Als ich das Gespräch entgegennahm, erkannte ich auch die Stimme nicht sofort. Ein paar Augenblicke brauchte ich, dann war mir klar, mit wem ich sprach. Renate war im Sommer 2007 in derselben Reisegruppe wie ich gewesen, die die Westukraine, das frühere österreichische Kronland Galizien und die Bukowina, besuchte. Wir hatten nach der Reise regelmäßig Kontakt gehabt, uns dann aber aus den Augen verloren. Der Anlass ihres Anrufs sei ein trauriger, sagte sie, gestern habe die Invasion der Ukraine durch russische Truppen begonnen, da sei unser Besuch Galiziens wieder lebendig geworden, verbunden mit der Hoffnung, dass wenigstens der Westen der Ukraine vom Krieg verschont bleibe und der Krieg überhaupt ein absehbares Ende fände, wenn diese Hoffnung auch eine sehr schwache sei. Die Ereignisse, so Renate, hätten sie betroffen gemacht und sie nach Jahren des Schweigens zwischen uns zum Telefon greifen lassen.
Die Nachrichten vom Krieg hatten mich genauso ergriffen, vielleicht hatte mich anfangs die Illusion, der Krieg betreffe vor allem Osteuropa, getäuscht, aber Renates Anruf hatte die globale Gegenwart dieses Konflikts deutlich werden lassen und dass er jederzeit auf das Gebiet der EU und der NATO übergreifen könnte. Und selbst wenn „wir“ von direkten Kampfhandlungen verschont bleiben sollten, Millionen Flüchtlinge würden Europa mit den Folgen des Konflikts konfrontieren. Nicht nur die damalige Reise, vor allem die nach wie vor lebende kulturelle und literarische Verbindung mit dem ehemaligen Galizien und der Bukowina verstärkten unsere Betroffenheit, machten sie gegenüber den abstrakt wirkenden stündlichen Nachrichten in Radio und Fernsehen und den überquellenden kontroversiellen Äußerungen in den sozialen Medien konkret. Komm nach Wien, sagte Renate, die Geschehnisse verstören und deprimieren uns zwar, aber im Café Sperl finden wir sicher Zeit, auch über Erfreuliches zu reden. Und Reminiszenzen an die gemeinsame Reise dürfen wir uns erlauben, sagte sie, gerade dem Krieg zum Trotz. Das sehe ich auch so, sagte ich. Ich komme.
Anfang der 2000er Jahre las ich in der Wochenendausgabe einer Zeitung einen Essay über Karl Emil Franzos, den aus Galizien stammenden Schriftsteller und Journalisten. Er, 1848 geboren, ging wie viele seiner jüdischen Glaubensgenossen aus dem Schtetl des Ostens nach Wien, später nach Graz, schloss dort ein Studium der Rechte ab, sah sich aber eher als Schriftsteller denn als Jurist. Er war Redakteur bei der Neuen Freien Presse, gab Büchners Werke heraus, um sich schließlich mit seiner Frau in Berlin als Schriftsteller niederzulassen. Von dort setzte er sich für Juden in Russland ein, deren Lage im Zarenreich immer unsicherer wurde. Er war herzkrank und starb mit 56 Jahren in Berlin. Auf dem wunderschönen jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee hat man ihm ein Ehrengrab gewidmet. Die im Essay beschriebene geographisch nahe Landschaft, die historisch doch ferne Zeit, von der ein faszinierender Mythos ausgeht, der Sog, den Wien und das fernere Berlin auf Teile der jüdischen Bevölkerung ausübten, zogen mich in ihren Bann. Der Essay schilderte eindringlich und dicht die damalige Verbundenheit des östlichsten Kronlands der Habsburgermonarchie mit der deutschen und österreichischen Kultur und die Anziehungskraft der Hauptstadt Wien, in der viele der vor allem jüdischen Zuwanderer den sozialen Aufstieg erhofften.
Ich hatte vorher nichts von Franzos gewusst, vielleicht hatte ich einmal flüchtig über ihn gelesen, es aber vergessen. Ich spürte eine anwachsende, unruhige Neugier, die unbedingt gestillt werden wollte, und suchte nach Informationen und Büchern von Schriftstellern aus dieser literarischen Landschaft. Obwohl es die Sowjetunion seit einigen Jahren nicht mehr gab, stellte Galizien, das Teil der Ukrainischen SSR gewesen war und nun in der unabhängig gewordenen Ukraine lag, für mich immer noch ein exotisches, nicht nur durch die Sprache getrenntes Land dar, schwer erreichbar, mit einem Substrat versehen, das zur österreichischen Identität wesentlich beigetragen hatte. Die Vorstellung der Exotik wurzelte in der Unerreichbarkeit hinter dem Eisernen Vorhang während des Kalten Krieges, aber in den 1990er Jahren traf sie bald nicht mehr zu. Die imaginäre Reise mit dem Zug, auf die sich Martin Pollack Mitte der 1980er Jahre in seinem Buch Nach Galizien begeben hatte, konnte man nun völlig real antreten. Denn Lemberg, die Hauptstadt des früheren Kronlandes Galizien, nur etwa 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, ist, was uns angesichts des Krieges im Jahr 2022 deutlich wird und Angst macht, Wien beinahe näher als Bregenz, vielleicht nicht nur geographisch, auch, was die Mentalität der Menschen betrifft.
Nach der Öffnung der ehemaligen Sowjetrepubliken entstand fast eine Reiselust, gepaart mit altösterreichischer Nostalgie. Sie erfasste in literarischer Hinsicht einige Jahre darauf auch mich. Ich hatte natürlich, bevor ich über und von Karl Emil Franzos las, fast alles von Joseph Roth gelesen, ich kannte Gedichte von Rose Ausländer und Paul Celan, und Galizien, allein schon der Wohlklang des Namens, hatte für mich eine geistige Aura, einen literarischen Nimbus als ein Quell der genuin österreichischen Literatur, die einen wesentlichen Beitrag zu unserer Identität darstellt. Joseph Roth ist der herausragende Name aus dieser Vielzahl an Persönlichkeiten, und die Auseinandersetzung mit ihnen würde den Umfang dieses Textes sprengen. Vergessen darf nicht werden, dass Roths Frau Friedl, als tragische Komponente von Roths gebrochen verlaufendem Leben, in Hartheim zu Tode kam, um es euphemistisch auszudrücken.
Die deutsche Sprache, das Jiddische, der Sog nach Westen brachten eine ganze Reihe Schriftsteller aus dieser Landschaft hervor, ebenso Schriftstellerinnen. Ich besuchte eines der selten gewordenen reichhaltigen Antiquariate, die es in Linz noch gibt, mit dessen Inhaber ich befreundet war, und fragte ihn, ob er Ausgaben von Karl Emil Franzos hatte. „Selbstverständlich“, sagte er und führte mich zu einem Regal, in dem nicht nur Werke Franzos’ standen, sondern zahlreiche literarische Namen Galiziens zu lesen waren. Ich konnte mich davon nicht mehr trennen und blieb eine lange Zeit in dem Antiquariat, las bekannte Namen, lernte für mich neue kennen. Plötzlich sah ich mich in Galizien, fühlte mich dort heimisch und den Literatinnen und Literaten nahe, ich spürte ihre Nähe, sie lebten trotz ihrer verblichenen Physis, und ich gehörte, da gab es keinen Zweifel, als ferner Verwandter zu deren Familie, wenigstens als Gast. Zwischendurch gab es Kaffee und ein paar Worte mit dem Antiquar.
Zuhause stieß ich einige Jahre später – ich glaube, in derselben Zeitung, in der ich über Franzos gelesen hatte – auf die Ankündigung einer Reise durch das ehemalige Galizien für den Sommer 2007. Ich bin mir sicher, mein Herz schlug schneller. Eine Art Fieber, dem Land nahezukommen, erfasste mich. So entschlussfreudig war ich gewiss noch nie gewesen. Ich meldete mich im Internet für die Reise an, zur Sicherheit griff ich zum Telefon, damit meine Anmeldung ja nicht im Cyberspace verschwand. „Wir müssen noch abwarten, ob für den gewählten Termin die erforderliche Mindestzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern zustande kommt“, sagte die Bearbeiterin. „Ich nehme auch jeden anderen“, sagte ich. „Warten wir ab“, sagte die Dame, „ich melde mich ein paar Tage nach dem Anmeldeschluss.“ Eine Zeit unruhiger Erwartung stand vor mir. Aber nach einigen Wochen rief mich das Reisebüro an und bestätigte, dass die Reise zum von mir gewählten Termin zustande komme. Ich war erleichtert und gespannt.
Der Bus fuhr bald in der Früh von der damaligen Zentrale des Österreichischen Verkehrsbüros ab, die gegenüber der Secession lag und heute das Kleine Haus der Kunst beherbergt. Reiseleiter war ein schon lange in Wien lebender, an der hiesigen Universität lehrender deutscher Historiker, der sich während der Fahrt durch Wien vorstellte. Er habe sich, sagte er, nicht nur in eine österreichische Frau, mit der er mittlerweile lange verheiratet sei, verliebt, ebenso in die österreichische Literatur und Lebensart. Dieses Geständnis milderte unsere Zweifel, ob ein deutscher Reiseleiter durch einen Teil Altösterreichs der geeignete sei. Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer stellte sich vor und skizzierte die Motivation für die Reise. Die Gruppe setzte sich aus historisch und literarisch Interessierten, Lehrerinnen und Lehrern, Pensionistinnen und Pensionisten zusammen. Die vor allem während der Monarchie in kultureller Hinsicht prosperierende Landschaft, die mit Österreich und der deutschen Sprache verwobene Geschichte, auch familiäre Wurzeln, was bei Renate zutraf, stellten die Gründe dar. Monarchisten oder Habsburg-Nostalgiker schien es nach meinen ersten Eindrücken nicht zu geben, zumindest betonte es niemand.
Durch Mähren erreichten wir die tschechisch-polnische Grenze bei Teschen, der Doppelstadt Cesky Tesin/Cieszyn, und betraten das polnische Westgalizien. Der Reiseleiter wusste eine Menge zu erläutern, es war anstrengend, ermüdend, ein paar Minuten Einhalt ließen mich aufatmen. In Krakau stieg er mit uns auf den Wawel, wo wir die Stadt wunderbar überblickten. Auf dem Hauptmarkt machte er uns auf die Tuchhallen aufmerksam. Kazimierz, das jüdische Viertel, hatte sich zu einer Touristenattraktion gewandelt, der Holocaust hatte das Viertel entvölkert, und der polnische Antisemitismus hatte sich nicht nur als stiller Beobachter beteiligt. Heute schleust man Reisegruppen durch den Stadtteil, nichtjüdische Musiker spielen Klezmer, nichtjüdische Köche bereiten koschere Mahlzeiten zu, und die Besucher sind von der gespielten Authentizität angetan.
Wir näherten uns der Ukraine, und als wir bei Przemysl die polnisch-ukrainische Grenze überschritten, betonte der Reiseleiter die Stellung der Stadt als Festung, die in mehreren Kriegen eine wichtige militärische Rolle gespielt hatte. Heute, im März 2022, flüchten wegen des Krieges in der Ukraine täglich zahlreiche Menschen über diesen Grenzbahnhof nach Polen, der an der Bahnlinie Krakau-Lemberg liegt. Die ukrainischen Grenzbeamten erledigten mit dem Reiseleiter die Formalitäten, sie betraten den Bus, nicht, um uns zu kontrollieren, sie begrüßten uns auf Deutsch und wünschten uns einen angenehmen Aufenthalt.
Wir betraten Ostgalizien, das ehemalige Kronland Galizien, das ich nur aus Beschreibungen und über die Biographien seiner Autorinnen und Autoren kannte. Die Landschaft, durch die wir in den nächsten Tagen reisen sollten, war ein nur kleines Gebiet der Ukraine, des zweitgrößten Landes Europas, das größte, wenn man es politisch sieht. Meine Neugier ließ mich den Hals recken, aus dem Fenster schauen, um jedes Haus, jeden Bach, jedes Merkmal, auf das der Reiseleiter aufmerksam machte, zu beachten und die Stimmung zunächst des Grenzlandes, dann des Landesinneren zu spüren, wenigstens zu erahnen. Atmete es noch einen Rest des alten Österreich, oder lebte dieses nur in Mythen und in den Werken seiner Dichterinnen und Dichter, in den Biographien seiner Intellektuellen weiter? Wir näherten uns den Orten, in denen jene Personen zur Welt kamen oder diese wesentlich formten, die wir für unsere Kultur, unsere Literatur beanspruchen. Ich war voller Erwartung, je näher Lemberg kam, Lviv heißt es auf Ukrainisch, Lwow auf Russisch. Es hatte – wie überhaupt Galizien – eine bewegte Geschichte mit wechselnder Zugehörigkeit zu Österreich-Ungarn, Polen, Russland, dann der UdSSR und Rumänien.
Unsere Köpfe wandten sich nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nichts wollten wir versäumen, alles im Auge haben. Wir folgten gebannt der Route des Busses und den Ausführungen des Reiseleiters, wir sahen typische Architektur der Habsburgermonarchie, die von den Zerstörungen der Kriege verschont geblieben war. Wir hatten gewissermaßen eine vertraute Stadt erreicht. Ganz in der Nähe liegt Grodek, das durch Trakls Gedicht in die Literaturgeschichte einging. Trakl lässt durch seine Sprache die Verzweiflung, die Zerstörung und die Brutalität des Krieges fühlen. Er war Sanitäter und in der Schlacht von Grodek im September 1914 mit den Verwundeten und Toten konfrontiert. Die furchtbare Realität des Krieges verkraftete er nicht und starb nach einer Überdosis Kokain. Ob er sie absichtlich genommen hatte oder es sich um ein Unglück handelte, ist nicht geklärt, aber der vermutete Selbstmord befördert den Mythos um Trakls Persönlichkeit. 1925 wurden seine sterblichen Überreste auf den Mühlauer Friedhof bei Innsbruck überführt.
An diesem herrlichen Sommertag hatte Lemberg eine mediterrane Aura, auf den Terrassen saßen die Menschen in der Sonne, ich dachte an eine Verwandtschaft mit Triest. Auch Klein-Wien traf die Ausstrahlung der Stadt. Die Leute promenierten auf den Boulevards, fast alle trugen Sonnenbrillen, nicht nur die Frauen waren elegant gekleidet. Wir stiegen im Hotel George ab, das 1901 nach Plänen des Wiener Architekturbüros Fellner & Helmer im Stil der Neorenaissance errichtet worden war und dessen riesige Halle den Eindruck weckte, wir hätten ein sakrales Gebäude betreten.
Mein Zimmer, eigentlich eine Suite, schien mir größer als meine Wohnung zu sein, jedenfalls riefen die Dimensionen, die hohen Räume, das erhöhte, barock wirkende Bett diesen Eindruck hervor. Die Möbel waren aus dunklem Holz, schwer und von imperialer Eleganz, sodass ich irgendwie die Gegenwart einer fiktiven Obrigkeit spürte, die aus kaiserlichen Zeiten zu kommen und mich als kleinen Untertanen zu betrachten schien.
Draußen in den Cafés saßen junge Leute, lachten, hatten Spaß. Wir nahmen in einem gegenüber der Oper, einer kleineren Ausgabe der Wiener Staatsoper, Platz. Die Stadt atmete Lebensfreude, jedenfalls im Zentrum. Solches im März 2022 angesichts des Krieges, der Lemberg näher rückt, zu schreiben, schmerzt nicht nur, es stellt sich die Frage, ob die Betonung der Fröhlichkeit, die damals an diesen Sommertagen dominierte, der heutigen Situation nicht unwürdig ist. Die Äußerung Adornos, die er später anders formulierte, „nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“ gründet auf noch verheerenderen Vorgängen, dennoch kommt sie mir in den Sinn. Andererseits wird die Beschreibung der Lebensfreude, ja der Lebenslust, der Stadt gerecht, die, wie die westliche Ukraine überhaupt, in Sachen kultureller Orientierung, politischer Demokratie, sozialer Ausrichtung zur westlichen Lebensweise, zur Europäischen Union tendiert.
Als wir gegenüber der Oper saßen, das Hotel George, die Parkanlagen und zahlreiche repräsentative Gebäude im Blick, bedurfte es keines Alkoholgenusses, um der Gemütlichkeit zu frönen und sich zu fragen, ob wir Österreich überhaupt verlassen hätten. Dennoch stießen Renate und ich mit einem Glas Rotwein an. Nur die Sprache der Menschen um uns bestätigte, dass wir in einem fremden Land waren. Keine Spur von der Angst, die 15 Jahre später vor dem Heranrücken der russischen Armee um sich greifen sollte, keine Spur von einem von Flüchtlingen überfüllten Bahnhof. Gegensätzlicher zu damals, zum Sommer 2007, könnten die heutigen Bilder nicht sein.
Etwas abseits vom belebten Stadtzentrum liegt die armenische Kathedrale, in die uns der Reiseleiter gewissermaßen als Antagonismus zum pulsierenden Leben führte. Wir kamen vom hellen Sommerlicht in Dunkelheit, die zahlreiche Kerzen kaum brachen, eine mystische Düsternis empfing uns. Wandmalereien von Jan Henryk Rosen aus den 1920er Jahren beeindruckten mich. Und von einer CD erklang der Gesang Lusine Zakaryans, wunderschön, aber unendlich traurig, sodass ich zwar in dessen Bann geriet, aber bald nach draußen in den Sommertag fliehen musste, zurück ins Licht, ins Leben. Ich hielt diese Melancholie nicht länger aus. Später betrat ich die Kathedrale nochmals und kaufte mir eine der aufliegenden CDs mit Zakaryans sakralen Liedern, sollte ich einmal in der Stimmung danach sein und diese jenseitsnahen Melodien ertragen können.
„Jede Freundschaft mit mir ist verderblich“: So schreibt Joseph Roth an Stefan Zweig, der ihn mehrmals finanziell unterstützte, Roths Niedergang, an dem sein Alkoholismus den größten Anteil hatte, aber nur verzögern konnte. Beider Leben war von den Wirren des Zweiten Weltkriegs, vom Antisemitismus und der Emigration geprägt. Wir erreichten die kleine Stadt Brody, in der Roth 1894 geboren wurde. Die Stadt hätte ohne ihren literarischen Sohn kaum die heutige Bekanntheit. Roth stammte aus einer jüdischen Familie, Brody hatte zur Zeit seiner Geburt einen jüdischen Bevölkerungsanteil von etwa 72 Prozent.
Die Synagoge war 2007 eine Ruine, sie ist es laut Internet immer noch. Niemand kümmert sich darum, leben in der Stadt doch kaum noch Juden. Wir hielten vor dem Gymnasium, in dem Roth maturiert hatte. Ein Mann zeigte uns das Klassenzimmer, in dem er angeblich Schüler war. Für Interessierte hatte man es wie zu Roths Zeiten eingerichtet, selbst die Unterrichtsgegenstände wie Tafelzirkel, Geodreieck und Ähnliches stellte man zur Schau, um der Roth-Verehrung gerecht zu werden. In einem Wandregal standen seine Werke in ukrainischer Sprache, einige auf Deutsch. Roth hätte diese Aufmerksamkeit zeit seines Lebens gebraucht, über achtzig Jahre nach seinem Tod 1939 dient sie wirklich nur der Nostalgie.
Einige Kilometer außerhalb von Brody liegt der riesige jüdische Friedhof. Wir fuhren hin. Die Grabsteine – es sind tausende – waren im Lauf der Jahrzehnte, bald Jahrhunderte in die Erde gesunken, standen kreuz und quer, waren zum Teil umgefallen. Dazwischen stand das Gras mannshoch. Niemand mähte es, man überließ den Friedhof der Natur. 1939 gab es die letzten Bestattungen. Die Gräber dürfen nach jüdischem Ritus nicht aufgelassen werden, also verfallen sie bis auf wenige Ausnahmen. Joseph Roth ist nicht hier begraben, er starb in Paris, sein Grab ist auf dem Friedhof von Thiais bei Paris.
Der Reiseleiter erläuterte, dass der Friedhof bei Brody eine einsame Stätte sei, es gebe kaum Besucher. Wenn jemand kommt, dann sind es amerikanische Juden, die nach ihren Vorfahren suchen, die aus Galizien schließlich in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind. An den Grabinschriften erkannte man bloß Bruchstücke von hebräischen, manchmal deutschsprachigen Namen und einzelne Buchstaben. So gab es eine Identifizierung eines Grabes nur, wenn eine jüdische Organisation die Koordinaten kannte. Vor Ort fanden die Nachkommen nur geborstene Grabsteine, die hilflos im Gras lagen, daneben den einen oder anderen Kerzenhalter, eine Vase ohne Blumen.
Am Westrand des Friedhofs befindet sich ein dreisprachiger Gedenkstein, der an die während der Aktion Reinhardt im angrenzenden Wald erschossenen Juden erinnert. Die heutige nichtjüdische Bevölkerung nahe dem Friedhof hatte, darauf wies uns der Reiseleiter hin, einen pragmatischen Zugang zum Ort: Größere Flächen am Rand nutzte sie als Garten und als Anbaufläche für Gemüse, Obst und Blumen, und niemand stieß sich daran.
Es gab noch eine Steigerung, was literarische Persönlichkeiten Galiziens betraf: Czernowitz, ukrainisch Czernivci, Hauptort der Bukowina, des Buchenlandes. Kleiner als Lemberg, doch diesem um nichts nachstehend, was die literarische Aura betraf, im Gegenteil. Mir fiel auch Joseph Schmidt ein, der Tenor, der vorwiegend Operettenmelodien und Schlager gesungen hatte, weil er für die Bühne zu klein war. Als ich noch ein Knirps war, hörte ich bei meiner Großmutter seine Stimme, etwa im Lied „Dein ist mein ganzes Herz“. Meine Großmutter hatte zwei Singles mit Schmidts Liedern. Viel später stellten sie für mich den reinsten Kitsch dar, da zählten der Rock und Woodstock, aber mit Renate habe ich Großmutters Singles wieder aufgelegt und Schmidts schöne Stimme gehört. Joseph Schmidt kam in der Nähe von Czernowitz, im Schtetl Dawideny, 1904 zur Welt. 1942 starb er in der Schweiz in einem Internierungslager nach der Flucht aus Deutschland, weil die medizinische Versorgung mangelhaft war.
Die galizischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind, obwohl sie längst nicht mehr leben, im literarischen Sinn lebendig, vielleicht ideell unsterblich. Es gibt, sofern sie von Krieg und Zerstörung verschont geblieben sind, deren Geburts- und Wohnhäuser, und deren Ansicht stärkt das Gefühl einer Verbundenheit. Dieses Gefühl wuchs in Czernowitz beträchtlich, als wir vor dem Geburtshaus Paul Celans standen und der Reiseleiter über ihn sprach, dessen Lyrik, ausgehend vom jüdischen Czernowitz, die moderne deutschsprachige Lyrik wesentlich beeinflusste, und das über die Todesfuge weit hinaus. Der Österreichbezug Celans ist auch in seiner fragilen Beziehung mit Ingeborg Bachmann begründet, von der der Briefwechsel zeugt. Paul Celan – Celan ist ein Anagramm von Ancel, seinem rumänisierten Geburtsnamen Antschel – steht in der Lyrik für die Moderne, für den Terror des Nationalsozialismus und die Verwerfungen des Zweiten Weltkriegs.
Doch gibt es andere Namen, die keinesfalls in Celans Schatten stehen: Rose Ausländer und Gregor von Rezzori etwa oder Selma Meerbaum-Eisinger. Auch der Biochemiker Erwin Chargaff stammt aus Czernowitz, er kam dort 1905 zur Welt. Sie alle zog es nach Westen, nach Wien, nach Berlin, in die Vereinigten Staaten. Nach dem Ersten Weltkrieg minderte sich die Dominanz der deutschen Kultur, der Zweite hatte die Vernichtung der Juden und den Ostblock zur Folge und die Dominanz des Russischen. Die Sowjetunion hatte kein Interesse an einer Pflege der Habsburgernostalgie, geschweige an einem Kulturtourismus, der, so die Befürchtung, Hand in Hand mit der Einsickerung revisionistischer Ideen hätte gehen können. Aber Anfang der 1990er Jahre, nachdem die Ukraine ein selbständiger Staat geworden war, konnte man der Habsburgernostalgie frönen, andererseits einem literarischen und kulturellen Interesse, dem viele Reisebüros nachkamen und es, wenn der Krieg hoffentlich beendet ist, wieder tun werden.
Czernowitz liegt ein paar Kilometer nördlich der rumänischen Grenze, es gehörte mehrmals zu Rumänien, es gab immer Beziehungen dorthin. Deshalb studierte Celan unter anderem auch in Bukarest. Und heute während des Krieges? Menschen aus dem Osten der Ukraine wählen auch den Weg über Czernowitz nach Rumänien in der Hoffnung, dass ihr Aufenthalt im Nachbarland nur ein vorübergehender sei und sie in ihre ukrainischen Städte und Dörfer zurückkehren können.
Die Rückfahrt führte uns in die Karpaten, wir hielten auf einem Bergplateau, wo uns ein folkloristischer Markt erwartete. Obwohl es selbst in den Bergen warm war, deckten sich einige Leute der Reisegruppe vorausschauend mit Winterkleidung ein, die die Händler anboten. Im slowakischen Kosice, auf Deutsch Kaschau, habe ich eine übermannshohe Mauer in Erinnerung, zu der uns der Reiseleiter eigens führte, die die dahinter lebenden Sinti und Roma von der restlichen Bevölkerung der Stadt trennte.
Als erste Reaktion war ich erbost, wenigstens verwundert über diese Ghettoisierung einer ethnischen Gruppe. Der Reiseleiter erläuterte, dass man den Stadtteil zunächst ohne Mauer für die Sinti und Roma errichtet hatte, Häuser, Spielplätze, Grünanlagen. Nach und nach fielen mutwillige Zerstörungen auf, Rohre, Leitungen, Kabel wurden aus Verankerungen und Verschraubungen gerissen und mit dem Müll, obwohl für diesen Tonnen bereitstanden, aus den Fenstern und in angrenzende Wohnviertel geworfen. So relativierte sich meine Empörung, und der Vorwurf der Apartheid oder der rassistischen Segregation kämpfte mit dem Verständnis für die Maßnahmen gegen mutwillige Zerstörung. Aber es blieb ein mulmiges Gefühl, glaubt man doch die Ghettobildung mitten in Europa angesichts der jüngeren Geschichte überwunden.
Die Reise hatte mich erschöpft, die Fülle an Eindrücken und Emotionen beinahe überfordert. Um diesen gewachsen zu sein, war Abstand geboten und ein Setzenlassen. Renate und ich vereinbarten ein Treffen in einigen Wochen, gefolgt von regelmäßigen Kontakten, um die Erinnerungen nicht verblassen zu lassen. Irgendwann war es dann doch so weit, wir verloren uns aus den Augen. Der Krieg, den Russland am 24. Februar 2022 begann, ließ als grausamer Katalysator unseren Kontakt wiederaufleben.
Günther Androsch
www.verdichtet.at | Kategorie: hin & weg | Inventarnummer: 22049