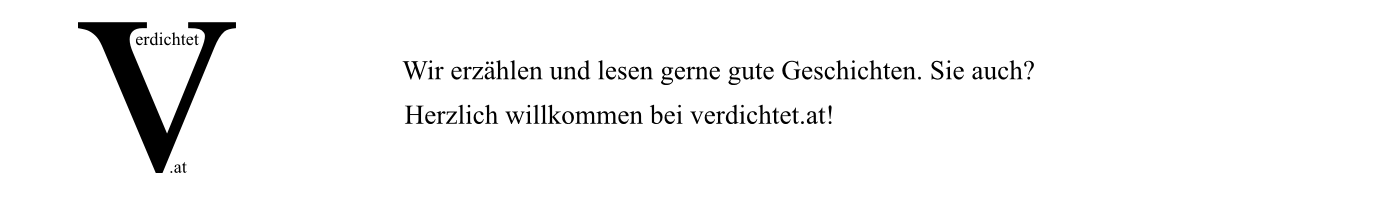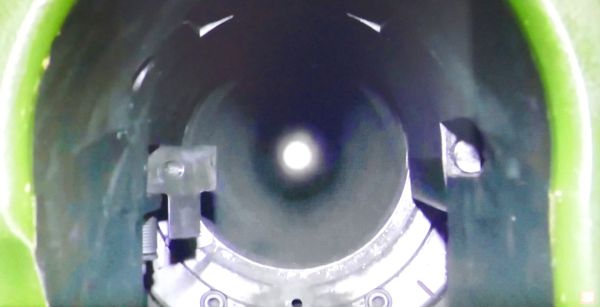Putins historische Rumpelkammer
„Die Russen haben keine schönen Erinnerungen, keinerlei Tradition, keine Geschichte, die unser Volk erzogen hätte. Wir sind ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Isoliert von der übrigen Menschheit, fehlt uns jede eigene Entwicklung, jeder wirkliche Fortschritt. Von den Ideen der Pflicht, der Gerechtigkeit oder Ordnung, welche die Atmosphäre des Westens ausmachen, sind wir ganz unberührt (...) Konfusion ist ein allgemeiner Zug in unserem Volk (...). Die Vorsehung scheint uns Russen völlig übergangen zu haben. Wir besitzen ein riesengroßes Land, aber geistig sind wir vollständig unbedeutend, eine Lücke in der Weltordnung. “
Diese Zeilen stammen keineswegs von einem zeitgenössischen Russland-Verächter aus dem Westen, so aktuell sie auch klingen mögen, sondern aus dem Gänsekiel des russischen Publizisten Pjotr Jakowlewitsch Tschaadajew, der 1829 in seinem „Ersten philosophischen Brief“ über die Zustände in Russland nachdachte. Der anfangs nur auf Französisch veröffentlichte Brief rief einen politischen Skandal hervor. Zar Nikolaus I., der kurz zuvor die Dekabristen aufhängen ließ oder in die sibirische Verbannung schickte, ließ Tschaadajew für verrückt erklären und verbot ihm jede weitere Publikation. Dieser antwortete darauf mit der „Apologie eines Wahnsinnigen“, in der er seine Thesen über Russland noch vertiefte. Er wies darin Russlands nur halb verstandene und unverdaute Rezeption der deutschen Romantik eines Schelling auf und die Unmöglichkeit eines richtigen Verständnisses von Hegel nach, weil Russland schlicht und einfach die realen staatlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen dazu fehlten. Kulturphilosophen wie Isaiah Berlin und Boris Groys zeigen in ihren Essays, dass die gleichen Missverständnisse auch beim ideengeschichtlichen Import von Marx und Nietzsche nach Russland passiert seien.
Tschaadajews Schrift ist der Anfang der bis heute andauernden Auseinandersetzungen zwischen den Strömungen der Slawophilen und der Westler. Wohin gehört Russland? Zu Europa, zu Asien oder ist es etwas Drittes? Präsident Putin, vormals halbgebildeter und von jeder moralischen zivilisatorischen Beeinflussung freier Mensch, KGB-Major, spielt sich neuerdings als Historiker und Philosoph auf.
Im Juli 21, und zuletzt gestern bei seiner TV-Rede zur Rechtfertigung seines kriegerischen Überfalls auf die Ukraine. Viele selbsternannte Russlandkenner schwafeln von der Lust Putins, die alte Sowjetunion wiederherstellen zu wollen. Alle schreiben voneinander ab, übernehmen Standards und Klischees für Redezeiten und Honorare.
Ich glaube aber, das ist anders. Ich stelle mir vor, dass er schon lange in irgendwelchen unterirdischen Verliesen des Kremls sitzt und auf großen Tischen ausgebreitete Karten des Zarenreiches studiert.
Das verfügte über eine viel größere Ausbreitung als die Sowjetunion je hatte, samt ihrem Vorfeld der osteuropäischen Satelliten- Staaten. Dazu dauerte das zaristische Imperium etwa 200 Jahre länger als die scheinbar unbesiegbare UdSSR. Ich kriege die Bilder von Chaplins Großem Imperator nicht aus dem Kopf, wie er tanzend am Globus dreht und sich in einen Rausch hineinsteigert.
Das Baltikum, Finnland, Teile Rumäniens, die Walachei und Bessarabien, Teile Polens, Teile Persiens gehörten damals zum Zarenreich. Das zaristische Russland kämpfte mit dem Britischen Reich um Indien bis nach China. Über solchen Karten brütet Putin und nicht über die Brösel der Staaten von Osteuropa. Im KGB aufgezogen, ist seine Devise immer noch: „Wenn du auf Stahl triffst, weiche zurück, auf Weiches stich ein und vernichte es.“
Der neo-faschistische Ideologe Alexander Dugin ist ihm so wichtig als sein Herzensphilosoph wie sein Beichtvater. Das Kerzerlanzünden, die Verneigungen und das Bekreuzigen – er beherrscht es übrigens noch immer nicht so perfekt, wie jemand, der von Kleinauf in der Orthodoxie aufgewachsen ist, nicht die richtigen Bewegungen beim Verbeugen, beim Ikonen-Küssen, beim Kniebeugen, alles angelernt, Camouflage und Propaganda, der neuerdings Gläubige. Ich schaue genau hin und erkenne Fälschungen.
Einige sind nun in der EU und Mitglieder der NATO. Er dreht am Globus und studiert die Landkarten. Zur Erholung legt er sich auf das Fell eines sibirischen Tigers und studiert seine Lieblingsphilosophen Ilja Ilin und Nikolaj Berdjajew, die Schriften der alten und neuen Eurasier wie Sergej Bulgakow, Putins lebender Leib- und Magen-„Philosoph“, ein lupenreiner russischer Faschist. Meine Moskauer Freunde erzählen mir, er beratschlagt sich mit ihm so viel wie mit seinem Beichtvater. Wie sich da die Kreise schließen, der atheistische KGB-Agent im Einfluss von ideologischen Extremisten. Vielleicht wird die vordergründige Irrationalität des Krieges Putins gegen die Ukraine verständlicher.
Wie alle Halb- und Viertel-Gebildeten frönt Putin dem Eklektizismus und der Geschichtsklitterung, kurzen, nicht zu Ende gedachten Parallelen und verführerischen Übertragungen von Vergleichen in die Gegenwart, mit zunehmender Leidenschaft und zunehmendem Realitätsverlust. Ich glaube, er ist ein armer Irrer. Allein in den Kasematten, in denen noch das Blut von Ivan, dem Schrecklichen, Boris Godunow und den von Peter, dem Großen hingemetzelten Strelitzen klebt, kratzt er sich die Glatze und die nackte Brust unter dem Judo-Kostüm, streichelt ein sibirisches Pferd und krault die Kehle eines Delphins aus dem Schwarzen Meer. Einige von ihm dort gefundene Amphoren wird er um sich aufgebaut haben. Niemand aus seiner Entourage wagt es, den Grill mit den fetten, selbstgeangelten Kamtschatka-Forellen anzuwerfen. Aber die Bilder davon, die er in seiner Selbstinszenierung in die Welt geschickt hat, haben alle Menschen im Kopf.
Dazu noch der Flottenführer und der Kampfpilot mit Ray-Ban-Brille und einer 25.000 Euro teuren Schweizer Uhr am muskulösen, braungebrannten Handgelenk. Vielleicht darf seine Langzeit-Geliebte Alina einmal in den Keller hereinspähen. Nein, er denkt. Aber seine Leidenschaft wird von etwas anderem als von der hübschen, halb so alten usbekischen Turnerin gespeist. Er dreht wieder den Globus und beugt sich über die Karten.
Ukraina, die Brüder, Malorossia, Kleinrussland, Belorossia, Weißrussland, das hab ich schon.
Es geht um die Ukraine, sie ist unser, wir sind eins, also ich selbst, also darf ich sie umbringen. Ich darf die Hälfte von mir töten, weil das bin ja ich.
Der schwarze Gürtel ist weg, ihm vom Judo-Weltverband abgesprochen, auch schon wurscht, bald gehört mir die ganze Welt. Er denkt kurz, keine langen Züge, von A nach B und was ergibt vielleicht C? Das hat er nie gelernt. Weder in den Leningrader Slums noch beim KGB. Jura – Jus hat er studiert, da muss ich immer lachen. Was war denn in der Sowjetunion „Recht“? Rechtswissenschaft in der KGB-Akademie?
Putin, der Jurist? Ich kriege Hirn- und Magenschmerzen und innerliche Wutanfälle, wenn ich so etwas von unbedarften Russland-Kommentatoren zu hören bekomme. Schild und Schwert, steht auf dem Wappen des KGB. Ursprünglich die Tscheka als Waffe gegen die Konterrevolution, aber nach dem Sieg der Bolschewiken ein „Schild und Schwert“ gegen den Westen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Unter Schild und Schwert (schit i metsch) ist Putin sozialisiert worden. Wenn man seinen aktuellen Reden zuhört, hat sich daran nichts geändert, bis auf die Ausweitung auf seine zaristischen Ambitionen.
Ich habe noch vor Augen die Bilder vom ersten Besuch eines wichtigen westlichen Gastes, des englischen Premiers Tony Blair in St. Petersburg mit seiner hochschwangeren Frau. Wie er in der Zarenloge des Mariinski Theaters saß, wie er seine triumphalen Blicke und Gesichtszüge kaum unter Gewalt bringen konnte. Da gingen viele Gewitter ab. Der räudige Straßenhund aus dem Hinterhof, ein schlechter Schüler, ein Rowdy, den nicht einmal der KGB aufnehmen wollte, am Ziel, so sah ich ihn, das war 2004, kurz vor seiner ersten Wahl.
Die ukrainische Bevölkerung sitzt in Kellern und U-Bahnstationen, Putin sitzt in den Kreml-Gewölben. Keller gegen Keller. Wer ist lebendiger? Wer hat mehr Zukunft? An welcher Seite sind wir?
Als der jüngste Vertreter des alten Slawophilen-Huts hat sich am 16. April 2014 der russische Präsident Putin geoutet. Während seiner vierstündigen „Ansprache zum Volk“ schwadronierte er von der Opferbereitschaft und der Leidensfähigkeit der Russen, was ihre moralische Überlegenheit gegenüber dem Westen ausmache. Die Kernbotschaft seines in allen großen Fernsehkanälen direkt übertragenen Schmierentheaters lautete: Der russische Mensch, der Mensch in der russischen Welt, das russische Volk ist bereit, für die russische Welt zu sterben. Opfer, Leiden, Sterben – das war immer schon ein beliebter Zynismus der Diktatoren. Er hatte wenige Tage davor die ukrainische Krim besetzen lassen und war gerade dabei, den Krieg in der Ostukraine anzufachen.
„Dulc(e) et decorum est pro patria mori“– Süß und ehrenhaft ist es, für das Vaterland zu sterben, dichtete schon Horaz in den Carmina III.2.13.
Putin hat das territoriale Russland ausgedehnt auf „die russische Welt“, und die ist laut Putin überall dort, wo russische Menschen leben und russische Interessen betroffen sind: die Krim, die Ukraine, das Baltikum, Transnistrien, Georgien, Ossetien oder weiter bis in 1. und 4. Wiener Gemeindebezirk, nach Nizza und London, Kensington Park? „Mir scheint, dass der russische Mensch, der Mensch der russischen Welt, vor allem daran denkt, dass es irgendeine höhere moralische Bestimmung des Menschen gibt“, sagte Putin, der frisch gebackene Philosoph auf dem Präsidententhron. Das ist Rassismus pur. Wusste er nicht: laut einer UNESCO-Definition aus dem Jahr 1995, der „Glaube, dass menschliche Populationen sich in genetisch bedingten Merkmalen von sozialem Wert unterscheiden, sodass bestimmte Gruppen gegenüber anderen höher – oder minderwertig sind.“
Was in westlichen Ohren wie befremdliches Gefasel von Nationalmentalitäten klingen mag, ist aber das Hintergrundgeräusch eines beinharten geopolitischen Kampfes, zu dem Putin angetreten ist. Während er in den Nuller-Jahren etwa bis 2007 im Westen noch wie ein Wolf im Schafspelz Kreide gefressen hatte – siehe seine viel bejubelte Rede vor dem Deutschen Bundestag – trat mit seiner Stiftung „Russki mir“ erstmals in der postsowjetischen Zeit die neue imperiale Ideologie von Eurasia auf. „Die russische Welt kann und muss alle vereinen, denen das russische Wort und die russische Kultur teuer sind, wo immer sie auch wohnen, in Russland oder außerhalb. Verwenden Sie diesen so oft wie möglich – russische Welt.“ Die Tragik besteht darin, dass im Russischen mir/Welt und mir/Friede Synonyme sind. Warum, das hat mir bis heute noch kein Semiotiker zufriedenstellend erklären können, nicht einmal Noam Chomsky. Er kann trotz seiner russischen Herkunft kein Russisch.
(Zit. Nach Ulrich Schmid: Russki mir. Dekoder 2016.)
Zur Ideologie der „russischen Welt“ gehört wie ein siamesischer Zwilling das „nahe Ausland“. Gemeint ist damit die Einflussnahme auf die ehemaligen Sowjetrepubliken, deren Selbständigkeit in den Tiefen des Kreml nie anerkannt wurden. Georgien, die Ukraine, Moldawien haben es am eigenen Leib verspürt, für die anderen ist das eine ständige Bedrohung.
Mit der Gründung der „Eurasischen Wirtschaftsunion“ 2014 wollte sich Putin den langgehegten Wunsch nach einem Gegenprojekt zur EU erfüllen. Neben Belarus und Kasachstan konnten sich lediglich Armenien und Kirgistan zum Zusammenschluss durchringen. Sie ist aber eine wirtschaftliche und eine ideologische Totgeburt geblieben. Seit der Krim-Annexion und dem Krieg in der Ostukraine mit den nachfolgenden Sanktionen ist sie sicher nicht attraktiver geworden. Erst mit dem Einstieg in den Syrien-Krieg zur Unterstützung des Assad-Regimes konnte er sich auf die Weltbühne katapultieren und mit seinem Konkurrenten USA auf Augenhöhe stehen. Die „russische Welt“ hat er mit dem Siegerkonzert in die Ruinen von Palmyra getragen. Valeri Gergiev spielte am 6. Mai 2015 mit dem Orchester des Mariinski-Theaters Werke von Bach, was ungefähr so geschmackvoll war wie im besetzten Paris Wagner zu spielen. Ein Politporno, den man sich jederzeit auf YouTube reinziehen kann. Der Dirigent und das Orchester mit weißen Baseballkappen umringt von russischen und syrischen Militärs inmitten der Ruinen.
So wie Stalin in den 30-Jahren die Orientierung an einer ganzheitlichen, homogenen „sozialistischen Kultur“ erzwungen hat, so wird unter Putins Dirigat Russlands Geistesleben auf ein immer aggressiveres, einheitliches „russländisches Denken“ und seine „historische Mission“ eingeengt. Putins Monolog und das inszenierte Antwortspiel sollten als Einstimmung in eine Zeit kommender Opfer, der Wehrbereitschaft und des massenhaften Heldentums dienen, durch das sich laut Putin das russische Volk vor allen anderen auszeichne.
Auch wenn es in der heutigen Welt viel Austausch gäbe, auch von Genen, könne Russland von anderen Völkern so manches aufnehmen, die Russen würden sich aber immer auf ihre eigenen Werte stützen, so auch die Bereitschaft, für ihr Volk zu sterben. „Gene“ waren im 19. Jahrhundert noch unbekannt, aber von den „ursprünglich russischen Werten“, die den Rest der Welt erlösen sollten, schwafelten auch schon die slawophilen Schriftsteller angefangen bei Gogol, den Brüdern Aksakov, Dostojewskij, Solowjow, Trubetzkoi bis zu Solschenizyn. Auch der für die Vorbereitung des Ersten Weltkrieges so bedeutende wie verheerende Panslawismus kommt aus den finsteren Winkeln des russischen Slawophilentums.
Putins Banalitäten über eine russische „Volkspsychologie“ und das Verhältnis zum Westen gleichen dem Ödipus, der bei Freud über den Ödipus-Komplex nachliest oder einem afrikanischen Häuptling, der eine Kubistenausstellung besucht, schreibt Groys. Er verkauft die russische Kultur als Realisierung der westlichen Träume und gleichzeitig als ihre Überwindung, nicht als das andere neben einem gleichen, sondern als die absolute Alternative. Was Putin so wütend macht, ist, dass trotz aller Lockangebote Russland für den Westen bisher immer ein Ort der Bedrohung geblieben ist. Am russischen Wesen wird die Welt genesen. Dafür gibt es schreckliche Beispiele.
Der von Stalin ermordete Dichter Josip Mandelstam warnte schon früh vor der eurasischen Krankheit, an der Russland leidet. „Die Russen haben eurasische Geistesanfälle, aber nur das Europäische hilft uns weiter.“ Er fragt, was Russland ohne Europa wäre, wäre es dann Russland plus Asien? Nein, denn es gehört keinem dieser zivilisatorischen Kreise an und wäre eine Leerstelle.
Der ehemalige KGB-Major Putin hat seinen Stalin genau gelesen. Mit ähnlichen Worten und Gedanken richtete sich Stalins Radiostimme einige Tage nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 an sein Volk, aus dem Bunker, in den er sich wochenlang verkrochen hatte. Stalin mobilisierte sogar die orthodoxe Kirche, die er seit seiner Machtergreifung gnadenlos verfolgt hatte, und gab ihr weitgehende Freiheiten, um die Kampfbereitschaft der Massen zu erhöhen.
Das hat Putin jetzt nicht nötig, er ist schlauer als Stalin, er hat die ROK mit sich an die Macht gebracht. Er, der ehemalige, kleine, kommunistische Geheimdienstagent, hat nach einem angeblichen Nahtoderlebnis zur Mutter Kirche gefunden und diese in seinen absolutistischen Machtapparat einbezogen.
Aus den Insignien des KGB von Schild und Schwert ist so ein Dreigestirn mit dem Andreaskreuz geworden, das über Russland herrscht. Die ROK hatte vor dem Prozess gegen die Aktionskünstlerinnen von Pussy Riot in einem Kreuzzug der staatlichen Medien sieben Jahre Haft wegen „Blasphemie und Erzeugung von Hass auf die Religion“ gefordert, immer vom Staat und seinen Medien konzertiert. Auch das Anti-Homosexuellengesetz ist ein lange gefordertes Zugeständnis an die Kirche, die in der Legalisierung der Homo-Ehe im Westen Vorzeichen für die herannahende Apokalypse sieht. Putins scheinbare Neuerfindung Russlands hat den Russen nach dem „Opium fürs Volk“, der Religion, nun das berauschende Gift des Nationalismus beschert. Ein russisches Sprichwort war schon einmal klüger als die derzeitige Politik: Wenn die Trompete ertönt, ist der Verstand im Wind.
Die ROK dient Putin noch auf eine andere Weise. Sie, die von Anfang an gegen den Westen, die lateinische Welt, gerichtet war – das vierte Rom als Erbe von Byzanz und Rom – versteht sich als das wahre Christentum, das rechtgläubige, das universale Christentum, das andere ist das abgefallene. So wie in allen imperialen Staatsformen von den Zaren bis Putin versucht die ROK als Staatsideologie den universalen christlichen Anspruch in politische Herrschaft überzusetzen. Das hat Putin gemeint, als er von der Überlegenheit der russischen Werte sprach, er beansprucht nicht mehr und nicht weniger als die Anerkennung einer größeren Universalität als die gesamte westliche Kultur.
Im Übrigen zeigte sich in den 80 Jahren des russischen Kommunismus – eine aus dem Westen von Russland angeeignete Ideologie – der gleiche gegen die westliche, kapitalistische Moderne gerichtete Anspruch, sich das Westliche anzueignen, um es besser bekämpfen zu können. Russlands antizivilisatorische Rückwende zum großrussischen Chauvinismus verrät trotz seines zur Schau gestellten dummdreisten Triumphalismus aber mehr von Schwäche als von Stärke. Was wie ein Meisterstück seiner Geheimdienste aussieht, die Besetzung und Annexion der Krim, ist kein Sieg, sondern der erste tönerne Fuß, auf dem Putin einknickt. So dialektisch kann Geschichte funktionieren.
Die russischen Werte, Vorteile, Vorzüge, die Opferbereitschaft und das Leidenspotential bestehen darin, mehr Wodka zu vertragen und mehr Kalaschnikovs zu verkaufen als alle anderen, das hat sicher jeder Politiker, Diplomat, Manager, Journalist oder Tourist schon am eigenen Leib erfahren.
Mit Tschaadajew kann man heute noch sagen, dass die russischen Verhältnisse so sind, dass man sie bei klaren Sinnen nicht ertragen kann. Es ist aber auch möglich, dass in den Kreml-Küchen ein Gebräu aus anderen Töpfen als Slawophilentum und ROK, zaristischem Imperialismus oder Stalinismus gebraut wird. Der bei uns vergessene Autor Konstantin Leontjew behauptete in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, „dass ausschließlich Unfreiheit und Unterdrückung eine geschichtliche Originalität eines Menschen oder einer Kultur hervorbringen (...). Ein befreiter Mensch oder eine befreite Kultur verlieren diese äußeren Grenzen und werden grenzenlos banal.“ Als Beispiel führte Leontjew, der längere Zeit auf dem Balkan verbracht hat, die Völker des heutigen Jugoslawiens und Griechenlands an, von denen er behauptete, dass sie nur im Zustand der Unterdrückung durch die Türken attraktiv waren. (Boris Groys, S 13).
Leontjew ist er jener Obskurant unter den Slawophilen, der meinte, wenn man Russlands Werte und Traditionen erhalten wolle, müsse man es einfrieren.
Die Selbstauflösung der Sowjetunion, für Putin die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts, hat in Russland exakt zu dem Zustand geführt, vor dem Leontjew gewarnt hatte. Putins Wende rückwärts in die Rumpelkammer der Geschichte wird weder Russland noch die Welt weniger düster machen. „Wir sind niemals mit anderen Völkern zusammengegangen, wir gehören keiner der großen Familien des Menschengeschlechts an, wir gehören weder zum Osten noch zum Westen, haben weder die Traditionen des einen noch des anderen. Wir stehen gewissermaßen außerhalb der Zeit, die allgemeine Erziehung des Menschengeschlechts hat uns nicht einbegriffen. “
Tschaadajews Klagen aus der Zeit des Dekabristen-Mörders Nikolai I. sind einhundertfünfundachtzig Jahre alt und klingen dank Putin leider wieder ganz aktuell.
26.4.14, 10 Tage nach der Annexion der Krim, ergänzt am 22.6.17, ergänzt am 25.2.22, 1 Tag nach dem Angriff auf die Ukraine
Veronika Seyr
www.veronikaseyr.at
http://veronikaseyr.blogspot.co.at/
www.verdichtet.at | Kategorie: ärgstens | Inventarnummer: 22044