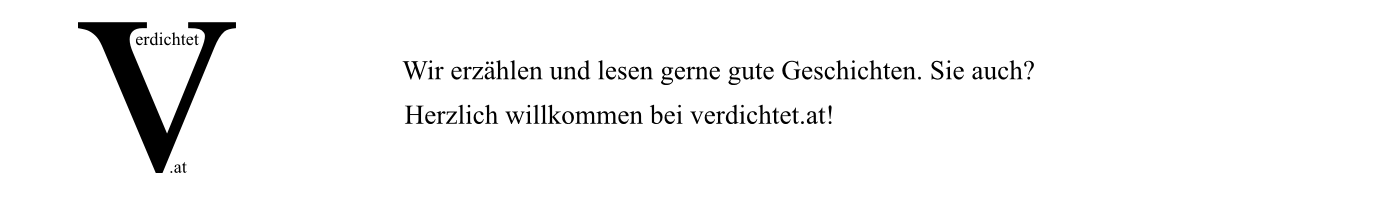Die Rache der Philharmoniker
Mein Chef, Botschafter Dr. Franz Cede, pflegte mich als seine Stellvertreterin zu Veranstaltungen zu entsenden, bei denen er verhindert war oder die ihm aus irgendeinem Grund nicht zusagten. Seinem eigentlichen Stellvertreter, dem jungen, unbedarften Botschaftsrat K., traute er das offenbar nicht zu; er nannte ihn nach dem alten Diplomatenwitz einen „Geschickten, nicht Gesandten“.
Dass K. sich nur gebeugt und im Rückwärtsschritt aus dem Botschafterkabinett entfernte, imponierte dem geradlinigen Cede nicht. Dabei unterließ er jeden Tadel, sondern seufzte nur einmal vor sich hin: „Wo hat der K. diese Unsitte gelernt? Hat der schon am Kaiserhof gedient?“ Ich bemerkte, wahrscheinlich habe er zu viele Sisi-Filme gesehen.
Der Botschafter bekam natürlich immer die interessantesten Einladungen, wollte doch jeder den obersten Repräsentanten der Republik bei sich haben und nicht unbedingt das dritte Glied. Außerdem war mein Allround-Service für ihn sehr bequem: Ich brauchte keinen Dolmetsch und keinen Chauffeur, ich kaufte das Blumenbouquet selbst ein, ich hielt Reden und überreichte Grußbotschaften, machte Taxi-Dienste und ging zur Not noch mit einem einsamen Besucher auf einen Absacker ins Kempinski oder National. Meine Tage schienen 48 Stunden zu haben.
Warum mich der Botschafter damals zum Konzert der Wiener Philharmoniker ins Tschaikowski-Konservatorium geordert hat, weiß ich heute nicht mehr. Aber es war mir „eine große Freude und besondere Ehre“ – mit diesen Worten begannen üblicherweise die Botschafterreden, die er nach zwei Jahren schon auf Russisch vom Zettel ablesen konnte –, die Philharmoniker begrüßen und anhören zu dürfen. Beim Dirigenten Valerij Gergijew hatte ich so meine Zweifel, bzw. wohlgenährten Vorurteile. Der Putin-Protégé hatte zwar schon Gastauftritte in Wien absolviert, aber noch nie mit den Philharmonikern.
Als ich vom Gartenring in die Alexander-Herzen-Straße – neuerdings in Bolschaja Dmitrowka umbenannt – einbog, geriet ich in eine Demonstration: Eine Menschenmasse schob sich auf beiden Seiten die Straße hinunter, auf der Fahrbahn stand der Autoverkehr. Je näher ich dem Konservatorium kam, desto klarer wurde mir, dass es sich um keine Demonstration handelte, sondern um Menschenmassen, die alle dem Konzert zustrebten. Ich konnte mich nur mit Mühe und mit Hilfe von zwei Milizionären zum Eingang durchkämpfen, das Riesenbouquet über meinem Kopf balancierend. Die Moskauer hätten ihre Großmutter verkauft, um an eine Karte der Wenskije Filgarmonisti zu kommen. Ich beobachtete tumultartige Szenen rund um die Türen. Unter Polizeischutz gelangte ich zur Künstlergarderobe, wo ich die Blumen endlich ablegen konnte, rote Rosen und weiße Lilien in einem Nest aus Philodendrenblättern, staatstragende Farben.
Als Staatsgast hatte ich einen Platz in der sechsten Reihe fußfrei, reserviert für die Prominenz. Er befand sich direkt unter dem Dirigentenpult. Die Philharmoniker marschierten unter dem frenetischen Applaus des Moskauer Publikums ein, gefolgt von Valerij Gergijew. Ohne einen Ton gehört zu haben, waren die Menschen schon außer Rand und Band, klatschten stehend und stampften mit den Füßen, dass es klang wie eine heranrückende Panzerarmee, unter der der Boden bebte. Die erste Hälfte war der Strauß-Dynastie gewidmet, die bekanntesten Ohrwürmer von der Blauen Donau, über Radetzki-Marsch, Kaiser-Walzer bis zu Polka schnell, Prater, Wienerwald, Champagner-Serenade und einigen Stücken, die Johann Strauß Sohn in Zarskoje Selo geschrieben hat.
In Moskau war es damals üblich, in Ermangelung eines Programmheftes, eine Ansagerin auftreten zu lassen, die in der übelsten Pathetik des Staatsfernsehens die Nummern ansagte, meiner Meinung nach eine unsäglich barbarische Sitte. Als der Vorschuss-Applaus endlich verstummt und Ruhe eingekehrt war, nach unzähligen Verbeugungen der 72 Männer (es gab damals noch keine Musikerinnen bei den Philharmonikern) alle Platz genommen hatten, erklangen die Walzermelodien.
Eine zweite Unsitte hatte in russischen Konzertsälen und Opern Einzug gehalten: Bei besonders bekannten Stücken mit hohem Erkennungswert auf offener Bühne zu klatschen und durch anhaltenden Applaus eine Wiederholung zu erzwingen. Aber die Wenskije verweigerten dies, da konnte Gergijew noch so sehr fuchteln und strampeln. Sie blieben ruhig sitzen und schauten in Pokerface-Manier ungerührt vor sich hin.
Ach, Gergijew, wie konnte man ihn nur den Philharmonikern vorsetzen? Wer hatte diese unsägliche Idee? Die Manager von Gazprom, die das Konzert gesponsert hatten? Aber von den Wienern wusste man, dass sie nicht nur sehr gut spielten, sondern auch gut rechnen konnten. Gergijew mochte noch so sehr rudern, die Philharmoniker spielten, wie sie immer und überall spielen. Sie brauchten auch überhaupt keinen Dirigenten, sie bildeten immer den gleichen genialen Klangkörper. Sie hätten auch im finstersten Verlies genauso gespielt. Gergijew, ein ossetischer Hüne von Gestalt, mühte sich redlich ab mit ausladenden Gesten und kam so sehr ins Schwitzen, dass die Schweißtropfen aus seiner langen Mähne und dem Gesicht bis in die sechste Reihe spritzten.
Ich hatte den Eindruck, dass die Musiker sich sogar den Spaß machten, ihm davonzugaloppieren wie eine Reitertruppe des Tschingis Khan oder in Ton und Tempo zurückzufallen zum zartesten Pianissimo, unabhängig davon, welche Anstrengungen und Verrenkungen er unternahm.
Aber, um Gottes willen, welcher Teufel hatte Gergijew geritten, sich nicht an die Kleidungstradition der Philharmoniker anzupassen, sondern in einem violetten Langhemd aufzutreten, in dem silbrige Lurex-Fäden glitzerten? Schon bald war es schweißdurchtränkt und zeigte dunkle Flecken auf dem Rücken und unter den Achseln. Er streckte sich oft so sehr in die Höhe, dass es hochrutschte, oder er ging so heftig in die Knie, dass die Mittelnaht der Hose zu platzen drohte. Sein Dirigat beschränkte sich nicht nur auf die Arme, sondern er setzte auch seine Füße ein, stampfte auf, schlenkerte sie so heftig vor und zurück, dass ich fürchtete, seine Hose würde gleich herunterrutschen, und er würde sich wie ein Riesen- Rumpelstilzchen in der Mitte auseinanderreißen und im Podium versinken.
Auch ich als unbeteiligte Zuhörerin war von dieser atemberaubenden Akrobatik schon schweißgebadet. Vielleicht nahm das alles nur mein böser Blick wahr, das Publikum jedenfalls war außer Rand und Band. Von den Gesichtern der Musiker konnte ich keine Gefühle ablesen, sie schauten stoisch vor sich hin, eine Phalanx aus gepflegter Langeweile – fadesse oblige. Nur ab und zu meinte ich, Anzeichen von unterirdischen Blitzen wahrzunehmen, ein lautloses Zucken wie in einer von weitem heranrollenden Gewitterfront. Welche Nervenstärke! Vielleicht standen sie das einzig beim Gedanken ans Konto durch, so wie eine fromme Ehefrau beim Beischlaf an die Jungfrau Maria.
Vielleicht ging ihnen gar nicht mal dieser Clown am Dirigentenpult am meisten auf die Nerven, sondern das noch kulturferne Gazprom-Publikum der Neureichen, das dem Gebrauch der gerade aufkommenden Handy-Kultur frönte. Geklingel, Gepiepse, Gespräche, kleine Blitze und blau leuchtende Bildchen zwischen den Reihen. Wer zahlt, schafft an. Ich habe vor Jahren einmal im Musikverein erlebt, wie sich das Orchester beim ersten Huster wie ein Mann erhob und abzog. Leicht benommen überstand ich die erste Hälfte und konnte in der Pause mit weichen Knien den Blumenstrauß an den Kapellmeister loswerden, zusammen mit den Grüßen des Botschafters, im Namen der Republik. Maestro Gergijew bekam von Gazprom ein noch dreimal größeres Bouquet, überreicht von einer wunderschönen jungen Frau, hart an der Grenze zur Edelnutte, wie man sie neuerdings in den Moskauer Hotel-Lobbys herumsitzen sieht.
Die größte Sünde haben aber meiner Meinung nach die Programmgestalter begangen – nach den Strauß-Melodien ein Tschaikowski-Potpourri anzusetzen. Und wieder erlaubten sich die Philharmoniker einen musikalischen Scherz: Wenn sie zeitweise den Strauß wie Tschaikowski gespielt hatten, schlugen sie bei Tschaikowski Strauß-Töne an. Gegen den Strich. So schaut die Rache der Philharmoniker aus, eleganter, lustiger und genialer geht es nicht. Auch nicht bösartiger und schräger, Strauß wie Tschaikowski und Tschaikowski wie Strauß klingen zu lassen!
Wieder einmal nur mein lange gepflegtes Vorurteil, dass ein einziger Strauß-Walzer mehr musikalische Einfälle enthält als eine ganze Tschaikowski-Symphonie? Er hat eine nette, eingängige Idee, die er dann vier Sätze hindurch variiert und auswalzt. Ich sehe immer den jungen Tschaikowski mit glühenden Ohren im Musikpavillon von Zarskoje Selo stehen, seine ersten Werke in den Händen drehend und auf einen Moment wartend, sie dem Maestro aus Wien übergeben zu dürfen.
Die Russen liebten und verehrten natürlich ihren Tschaikowski grenzenlos, sahen aber auch in Strauß einen Fast-Russen mit seinen 13 Saisonen in St. Petersburg und seiner angebeteten Fast-Verlobten Olga Smirnitzkaja. Da macht es nichts aus, dass deren Offiziers-Vater im weltberühmten Konzertmeister und Kompositeur Strauß einen dahergelaufenen ausländischen und ungläubigen Zigeuner sah und als Ehemann ablehnte. Einmal fiel das Gastspiel fast aus, weil die russischen Zöllner die Strauß-Truppe als zwielichtiges Gesindel, vermeintliche Landstreicher festhielten und nicht in dieses kultivierte Land lassen wollten. Nur durch die Intervention aus dem Sommerpalast trafen sie doch noch rechtzeitig zur 10. Saison in Zarskoje Selo ein.
Was sollte ich machen gegen meine in Wien trainierten Ohren, angefangen von der Familienmusik über die ungezählten Konzerte der Jeunesse musicale bis zu den Abonnementkonzerten das ganze Leben hindurch, ganz zu schweigen von allen Neujahrskonzerten seither. Man kann das Gehör, das genealogisch tiefste und älteste Organ, nun mal nicht ummodeln, das ist eine physiologische Tatsache, Vorurteile hin oder her. Das ist wie eine DNA.
Erinnert und aufgeschrieben nach dem Neujahrskonzert 22 mit den Wiener Philharmonikern unter Daniel Barenboim und am 2.1. unter der 9. Beethoven auf Ö1.
1./2.1.2022
Veronika Seyr
www.veronikaseyr.at
http://veronikaseyr.blogspot.co.at/
www.verdichtet.at | Kategorie: unerHÖRT! | Inventarnummer: 22014